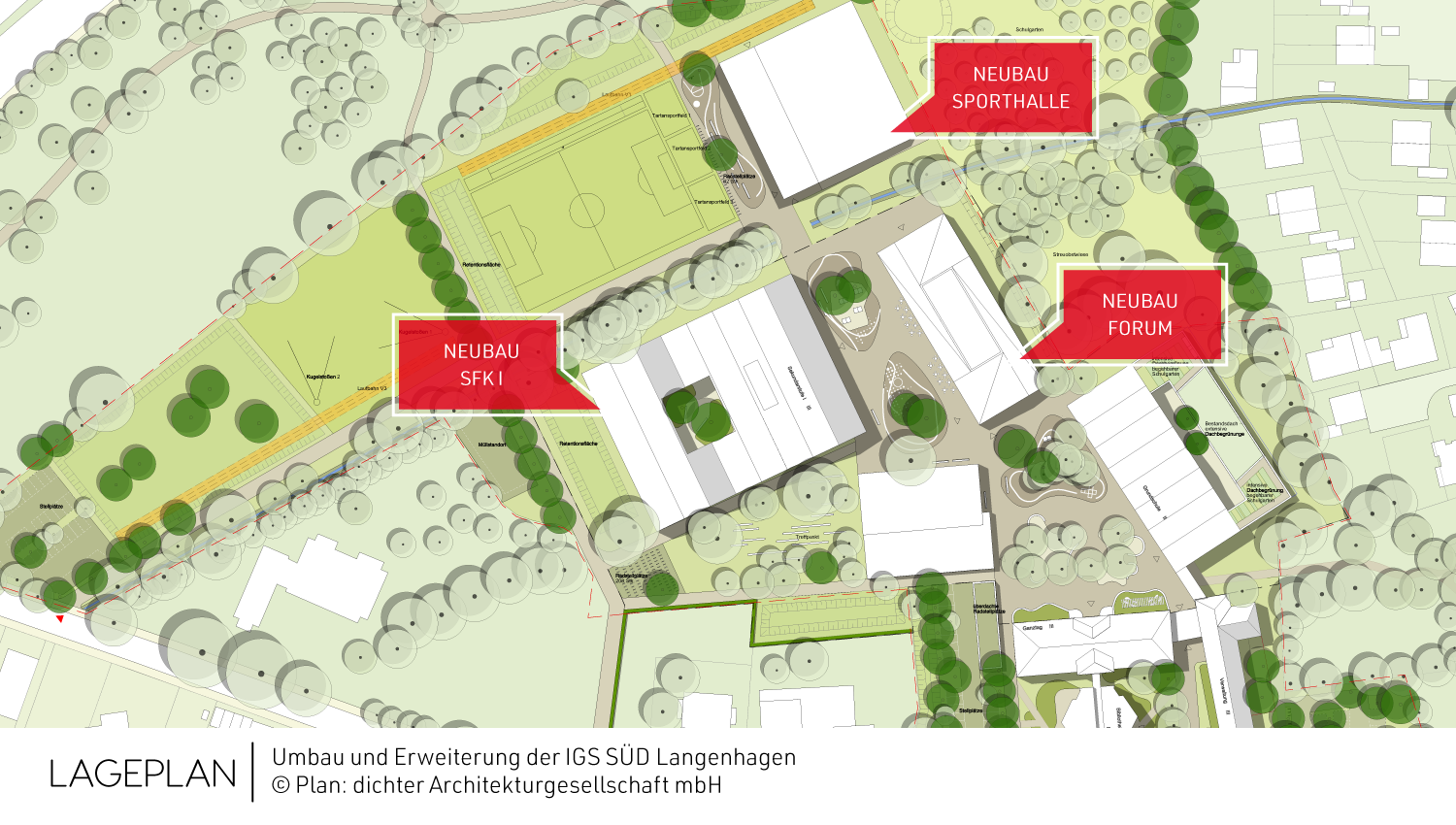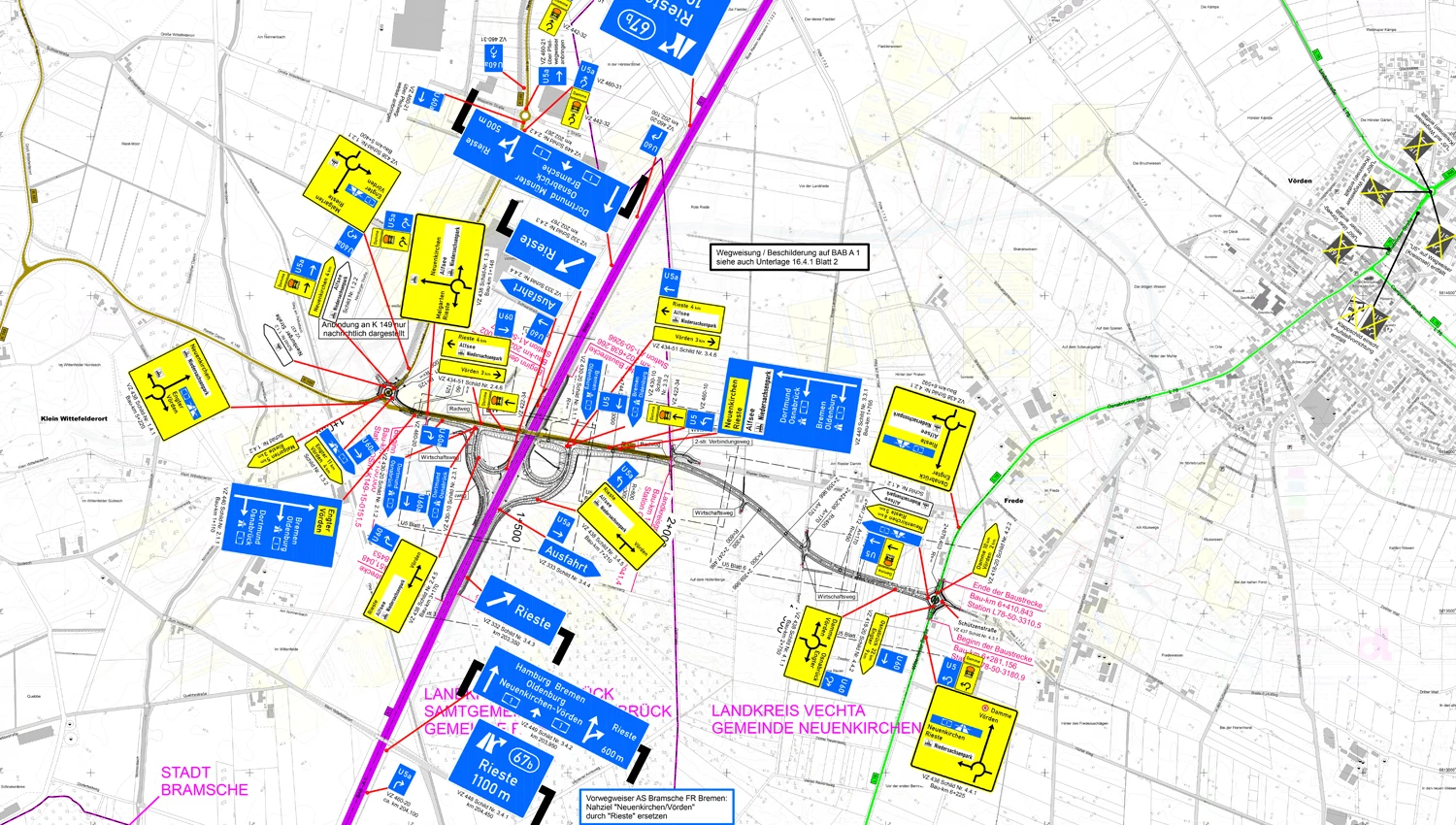Ab 1743 wurde der ursprüngliche Finowkanal – aus dem Jahre 1620 – mit einem verlängerten Streckenverlauf sowie insgesamt 12 Schleusen wiederhergestellt. Ab 1749 war der Kanal vollständig befahrbar. Er entwickelte sich zu einer der wichtigsten deutschen Binnenwasserstraßen. Dank des Kanals florierte die Industrie der Region bis ins 20. Jahrhundert hinein. 1914 ersetzte der Oder-Havel-Kanal die Wasserstraße, weil diese ihre maximale Leistungsfähigkeit erreicht hatte – der Finowkanal verlor an Bedeutung. Infolge dessen wurden nur noch die nötigsten Erhaltungsmaßnahmen vorgenommen, die historischen Schleusen verfielen.
Der Ausbau des Treidelweges von Finowfurt bis zum Schiffshebewerk Niederfinow zu einem Rad- und Wanderweg erweckte den Finowkanal seit etwa 2000 zu neuem Leben. Seit 2003 ist die Wasserstraße Teil der Landesdenkmalliste. Für die Berufsschifffahrt praktisch bedeutungslos, bietet die historische Wasserstraße Touristen und Freizeitskippern Stille, reizvolle Naturschutzgebiete und mit den Industriebrachen der Gründerzeit historische Zeugen der Geschichte der Region.
In diesem überwiegend ländlich geprägtem Raum bietet der Kanal Entwicklungspotenziale und wirtschaftliche Chancen. Um dieses Potenzial bestmöglich zu heben, verhandelte der Landkreis Barnim erfolgreich mit dem Bund die Übernahme der Schleusen durch einen kommunalen Zweckverband sowie die anteilige Kostenübernahme der Schleusensanierung. Die Planungen und die Umsetzung erfolgen voraussichtlich in zwei Bauabschnitten mit jeweils sechs Schleusen.
2019 wurde die INGE bestehend aus Fichtner Water & Transportation GmbH und GRBV mit der Planung der Sanierung für die ersten sechs westlichen Schleusen beauftragt. Eberhardt – die Ingenieure GmbH und Wol-Tec Automatisierungstechnik GmbH gehören als Nachunternehmer ebenfalls zum Projektteam.
Gedacht
Zahlreiche Proben aus den Schleusenbauwerken und dem Baugrund wurden genommen und analysiert. Die Schadensbilder wie Risse, Erosions- und Frostschäden, kippende Kammerwände, fehlende Sicherungsausrüstungen und die Ergebnisse der Probenanalysen führten letztendlich zu dem Ergebnis, dass fünf der Schleusen des ersten Bauabschnitts durch Neubauten ersetzt werden. Die Bewertung der Standsicherheiten kam zu dem Ergebnis, dass die Bauwerke teilweise im Revisionsfall nicht trockengelegt werden könnten.
Die Schleuse Schöpfurt wurde bereits 2003 Grundinstand gesetzt, so dass diese Schleuse nur mit neuer Technik ausgerüstet wird, um zukünftig eine automatische Schleusung zu ermöglichen.
Geplant
Bauen im Bestand – Denkmalschutz, Naturschutz, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit diktieren die Rahmenbedingungen
Beim Planen der neuen Schleusen fixierten eine Reihe an Auflagen der Denkmalschutzbehörde die Entwürfe. Die Ersatzneubauten müssen sich im äußeren Erscheinungsbild und ihrer Lage streng am historischen Original orientieren: Abmessungen, Grundrisse als Kammerschleuse mit versetzten Häuptern, typische Gestaltungselemente und geometrische Detailmaße des historischen Mauerwerks und der Schleusentore sowie wesentliche hydraulische Parameter galt es wiederherzustellen.
Zugleich war ein ambitionierter Zeitplan einzuhalten – sowohl im Zuge der Planung als auch während der Baumaßnahme. Natürlich galt es auch den festgelegten Kostenrahmen einzuhalten, besonders auch im Hinblick auf Folge- und Unterhaltskosten. Zudem sollen Wassertouristen den Kanal während der Baumaßnahme größtmöglich weiternutzen können, so dass Sperrzeiten auf ein Minimum reduziert werden müssen.
Enge Abstimmung mit den zuständigen Behörden, Ämtern und dem Archäologischen Landesmuseum bezüglich Denkmal- und Naturschutzauflagen begleiteten die Entwurfs- und Baustellenplanungen von Beginn an.
Entwurfs- und Ausführungslösung der historischen Schleusen
Die Bestandbauwerke hatten eine nutzbare Länge von 41,7 m und eine Breite von 9,6 m. Die schiffbare Breite im Bereich der Schleusenhäupter betrug ca. 5,3 m. Die Maße der historischen Schleusen orientierten sich am sogenannte Finowmaß, dem ersten genormten deutschen Binnenschiffmaß. Kähne, die nach dem Finowmaß gebaut wurden, waren 40,20 m lang, 4.60 m breit und hatten einen Tiefgang von 1,40 m. Die Schleusen konnte zwei Schiffe nebeneinander gleichzeitig aufnehmen.
Der Ersatzneubau bildet diese Abmessungen gemäß den Vorgaben des Denkmalschutzes wieder ab. Klinkervorsatzschalen nehmen das Erscheinungsbild der ursprünglichen Mauerwerkswände auf, Stemmtore und Umlaufkanäle orientieren sich ebenfalls am historischen Vorbild.

Schleuse Ruhlsdorf | Ausgleichschicht und Konstruktionssohle sind in Teilen fertig gestellt, wenn die Konstruktionssohle komplett fertig ist, können die letzten Aussteifungen ausgebaut werden.
Gebaut
Die Schleusen werden als U-Querschnitt in einer Spundwandbaugrube errichtet. Um das Bauwerk gegen Auftrieb abzusichern ragt die Betonsohle in der Horizontalen rechts und links über die Seitenwände hinaus. Während der Bauphase werden die Baugruben oben ausgesteift. Die Unterwasserbetonsohle wird mit Mikropfählen verankert.
Die alten Betriebsgebäude werden ebenfalls abgebrochen und neu errichtet. Das Betriebsgebäude an der Schleuse Ruhlsdorf steht unter Denkmalschutz. Es wird deshalb Stein für Stein abgetragen, fachgerecht saniert und im Anschluss denkmalgerecht wieder aufgebaut.
Neben den Auflagen aus dem Denkmalschutz sind auch gerade in der Bauphase Anforderungen des Naturschutzes umzusetzen. Dies betrifft in erster Linie die Zugänge zu den Baustellen und Lagerplätze für Baumaterial.
Mit Beginn des Jahres 2025 befinden sich alle sechs Schleusen, des ersten Schleusenpakets im Bau. In Ruhlsdorf wurde bereits die nördliche Kammerwand ausgeschalt, in Leesenbrück und Grafenbrück werden die Kammersohlen bewehrt und betoniert. Die Schleuse Heegermühle ist komplett abgerissen und in Wolfswinkel erfolgt derzeit die Baustelleneinrichtung.
Die Voruntersuchungen der Bauwerke und des Baugrunds für die nächsten sechs Schleusen werden derzeit vorbereitet. Das Ergebnis wird über „Neubau“ oder „Instandsetzung“ der sechs Schleusen des zweiten Bauabschnitts entscheiden. Die Entscheidung hierzu wird 2025 erfolgen.