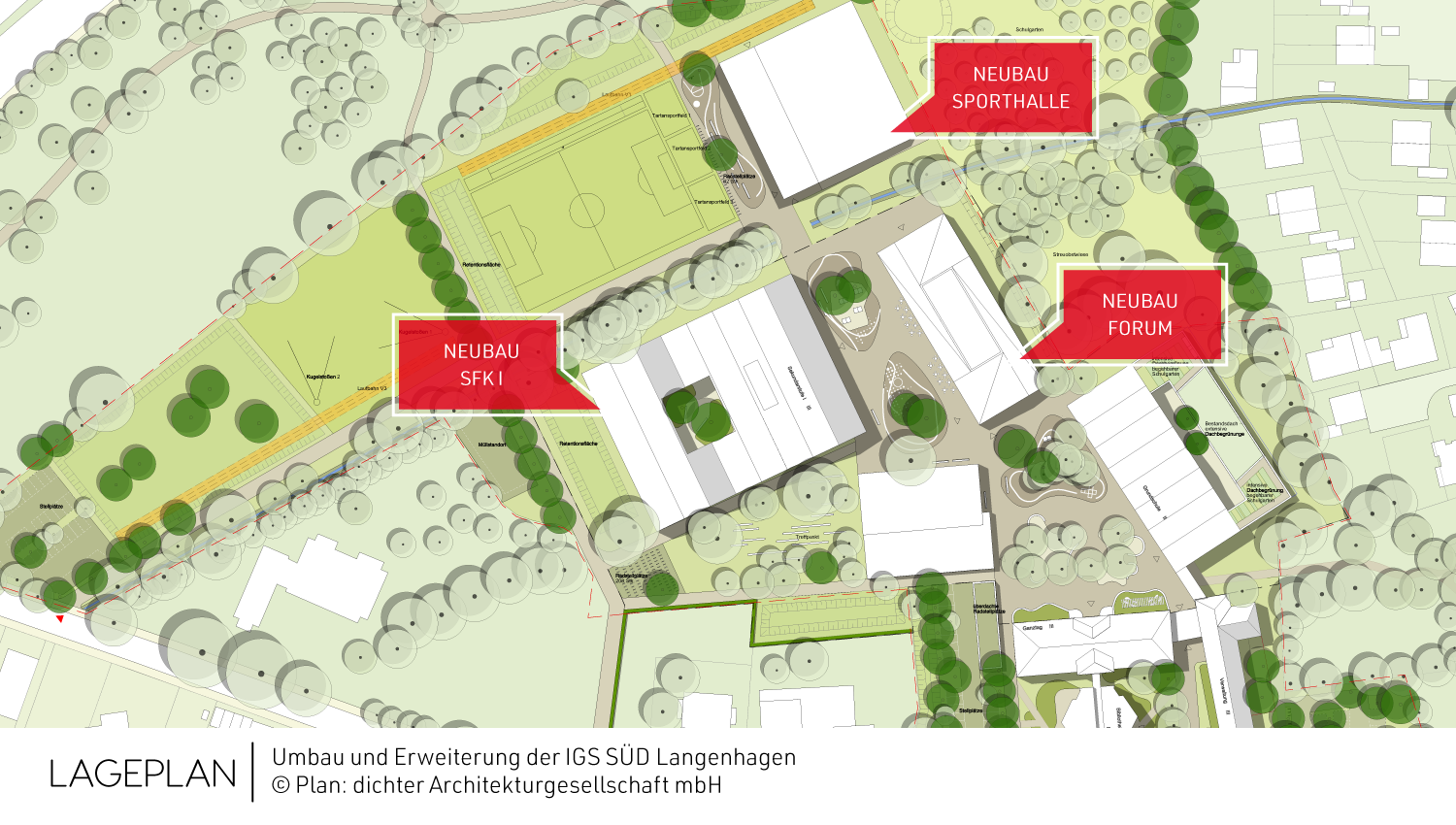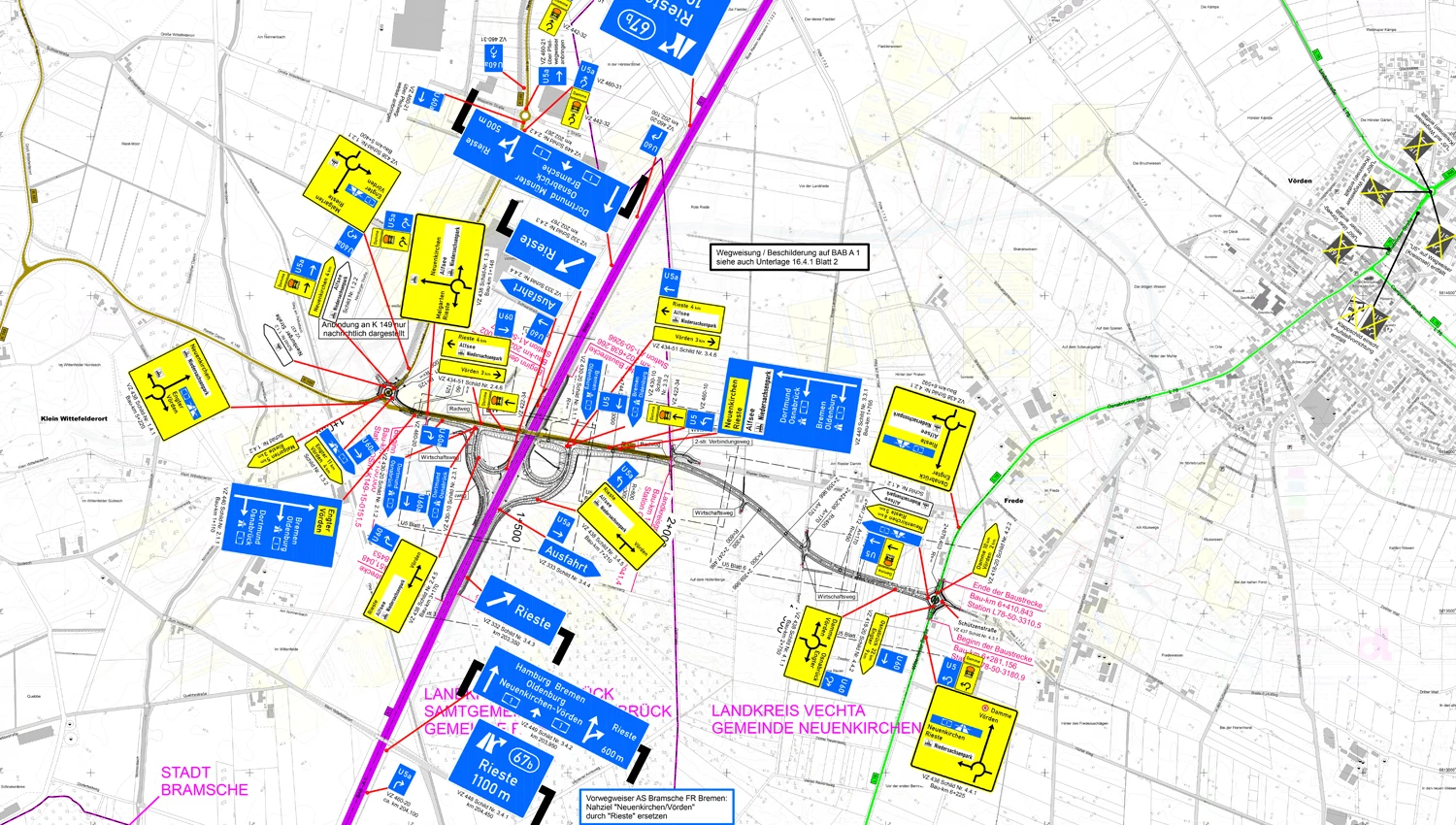Frühzeitiges Berücksichtigen von Umweltschutzauflagen bei der Planung helfen, Konflikte und Verzögerungen zu vermeiden
Welchen Einfluss haben Anforderungen des Umweltschutzes auf Bauvorhaben im Wattenmeer – Erkenntnisse liefert die Masterarbeit unserer Kollegin Annika Maasch. Diese Frage betrachtet die Arbeit detailliert am Beispiel des Tiefwasseranlegers der Insel Pellworm.
Natürlich müssen Bauwerke – sei es im Bestand als auch im Neubau – Anforderungen an technische Standards und Wirtschaftlichkeit erfüllen. Gerade in Schutzgebieten stellt aber der Umwelt- und Naturschutz maßgeblich zusätzliche Forderungen an Planende und Bauausführende. Im Falle des Tiefwasseranlegers Pellworm sind es die Auflagen, die sich aus der Lage im Nationalpark und dem damit verbundenen Schutzstatus ergeben.
Der tideunabhängige Tiefwasseranleger Pellworm dient in erster Linie dem Fährverkehr zwischen Insel und Festland. Chlorid bedingte Schäden an der Baukonstruktion und zunehmender Verkehr machen einen Ersatzneubau notwendig. Darüber hinaus gibt es Überlegungen, den Anleger um einen Materialumschlagplatz zu erweitern. Dieser wird unter anderem im Zuge umfassender Deichbau Maßnahmen benötigt.
Die Masterarbeit betrachtet verschiedene Konstruktions-Varianten und bewertet diese sowohl hinsichtlich technischen als auch umweltplanerischen Anforderungen. Wie beeinflussen diese die Auswahl der Vorzugsvariante und lassen sich hieraus Erkenntnisse für vergleichbare Projekte im Wattenmeer ableiten. Die Ergebnisse können zukünftig helfen, Lösungen bereits in frühen Planungsphasen zielgerichtet zu erarbeiten.
15 Abs. 1 des BNatSchG formuliert dazu Folgendes:
„Der Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. Beeinträchtigungen sind vermeidbar, wenn zumutbare Alternativen, den mit dem Eingriff verfolgten Zweck am gleichen Ort, ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu erreichen, gegeben sind. Soweit Beeinträchtigungen nicht vermieden werden können, ist dies zu begründen.“
Daraus ergibt sich, dass die Kriterien Technik, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz keine gleichberechtigten Partner bei der Bewertung darstellen. Ausschlaggebend ist letztendlich, ob die umweltplanerisch beste Variante zumutbar ist. Demnach wirft der Umweltschutz ein deutlich höheres Gewicht in die Waagschale.
Als Bewertungskriterien für umweltverträgliche Lösungen gelten u.a.:
- Geringer Flächenverbrauch
- Geringstmöglicher Einfluss auf das Ökosystem, wie bspw. Strömungsverhältnisse, Lärm, Aufwirbelung
- Lage in Schutzgebieten
Vier Varianten wurden für die Arbeit betrachtet. Die Varianten unterschieden sich u.a. in Bezug
- auf die Gründung – Stahlpfähle mit und ohne Nutzung des Bestandes oder als Aufschüttung
- die Materialwahl für die Überbauten – Stahl- oder Stahlbetonfertigteile,
- Sohlvertiefung – notwendig oder nicht,
- die bauzeitliche Ersatzlösung für den Verkehr,
- die Trennung der Verkehrsflächen für Fähr- und Umschlagbetrieb.
Jede Variante wurde zum einen hinsichtlich ihrer technischen, wirtschaftlichen und ökologischen Auswirkungen betrachtet und zusätzlich unter umweltplanerischen Bewertungsmaßstäben – und das über den gesamten Lebenszyklus des geplanten Bauwerks. Die Ergebnisse der Matrix ermöglichen schnell die Vorzugsvariante mit dem höchsten Genehmigungspotential zu identifizieren. Möglichst kleine Bauwerke außerhalb von unbebauten und/oder Schutzgebieten gegründet als Pfahlbauwerke sind da ein erstes grobes Bewertungskriterium.
Die Erkenntnisse aus der Masterarbeit lassen sich sowohl auf vergleichbare Projekte in Schleswig-Holstein als auch in Niedersachen und Mecklenburg-Vorpommern übertragen. Umso früher die Umweltplanung in Projekte eingebunden wird, umso besser können lokale Besonderheiten beim Ermitteln der umweltverträglichsten Lösung berücksichtigt werden.